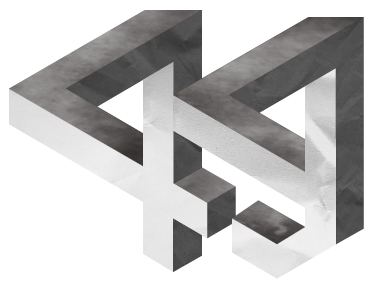Kapitel 2
14. November
Der Tag begann gemächlich. Nach dem Aufwachen blieb er noch im Bett liegen. Dr. Hansen hatte ihn vorsorglich für die nächsten Wochen arbeitsunfähig geschrieben, und es war ihm auch gleich, wer seine Arbeit in der Firma erledigen würde. Die Firma würde auch ohne ihn funktionieren, und dass er ohne die Firma gut klarkommen könne, stand für ihn außer Frage.
In einem so großen Unternehmen fällt es auch nicht sonderlich ins Gewicht, ob einer mehr oder weniger im Hause war. Natürlich würde der Geschäftsführer Heini die Ernsthaftigkeit seiner Erkrankung in Frage stellen. Streng genommen war Heini ja gar nicht der Geschäftsführer; er war nur Mitglied der Geschäftsleitung, wie es korrekt im Organigramm der Firma erwähnt war. Heini glaubte, diese Berufung aufgrund seines hohen Maßes an Fachwissen und seiner außergewöhnlichen Sozialkompetenz verdient zu haben. In Wirklichkeit hatte man ihn nur in die Geschäftsleitung berufen, weil er in seiner Abteilung nicht zu gebrauchen war und der Inhaber des stetig wachsenden Unternehmens einen Mann fürs Grobe brauchte: unangenehme Dinge wie Entlassungen aussprechen, langweiligen Abteilungsleitersitzungen beiwohnen und den Schriftverkehr mit Behörden zu überwachen sind Aufgaben, um die sich niemand reißt – es sei denn, man überzeugt einen seiner Mitarbeiter von der unbedingten Notwendigkeit dieser Aufgaben und gibt ihm zu erkennen, dass er – und nur er – genau der richtige für diesen neu geschaffenen Posten sei.
An dem Tag, als Heini in die Geschäftsleitung berufen wurde, glaubte er sich am Ziel. Niemand hatte ihm verraten, dass er nun ganz allein den Unmut der Belegschaft auf sich ziehen würde. Alle im Haus machten sich hinter seinem Rücken über ihn lustig, was Heini erst gar nicht mitbekommen hatte. Nachdem er feststellen musste, dass er als einziger keine Freunde in der Firma hatte, versuchte er zur Selbsttäuschung sich seine Unbeliebtheit als besonders herausragende Eigenschaft und unabdingbare Fähigkeit eines Geschäftsführers schön zu reden.
Heini war auch nicht sein richtiger Name, und er ließ auch nicht auf seine Gender-Zugehörigkeit schließen. Es waren einfach nur die Anfangsbuchstaben seines wirklichen Vornamens Heinz-Nikolaus. Gerne dachte Heini von sich als einem gutmütigen, fürsorglichen Chef, der aber auch mal laut werden konnte, denn er hatte ja seine Prinzipien – so wie alle Menschen, die sonst nichts im Leben haben.
Er verwarf seine Betrachtungen der Mittelmäßigkeit seines mitleiderregenden Mitmenschen und machte sich stattdessen daran, alles aufzuschreiben. Womit fängt man da an, dachte er bei sich und verfiel auf das ihm am nächsten liegende: Wenn man ein Tagebuch führen will, sollte man immer mit dem Datum beginnen. Heute war der 14. November.
- November?
Das ist doch der Geburtstag von Claude Monet. Den französischen Maler hatte man anfangs verspottet: „Impressionist“ war eine herablassende und geringschätzige Bezeichnung von sogenannten Kritikern.
Kritiker sind die Sorte Mensch, die Künstlern erklären, wie Kunst zu sein hat, obwohl sie – die Kritiker – selbst nie ein Kunstwerk geschaffen hatten. Um ihre eigene Unfähigkeit vor der Welt zu verbergen, waren sie dazu übergegangen, die Werke anderer zu beurteilen. Sie waren sich sicher: Wenn sie selbst nur lautstark, naseweis und mit einem ausreichenden Wortschatz ausgestattet pausenlos und selbstverliebt daher palaverten, käme niemand auf die Idee, in Wahrheit einem Dilettanten zu lauschen. Wenn einer so unablässig über ein so komplexes Thema wie Kunst sinnieren konnte, würde man ihn doch kaum der Sinnlosigkeit bezichtigen, oder?
Armer Monet.
Nicht nur, dass er anfangs kaum von seiner Malerei leben konnte – er musste sich auch noch vorwerfen lassen, gar kein Maler zu sein.
„Impressionist“ – ein böses Schimpfwort für einen, der im Stande ist, seinen natürlichen Eindrücken künstlerischen Ausdruck zu verleihen.
Monet wusste um die Bedeutung der Farbe,
um die Wirkung von Kontrasten,
helle und dunkle Schattierungen,
Dinge, die kaum noch sichtbar waren,
bis dann kaum noch etwas zu erkennen war
doch wer nicht hinschaut,
wer nur einen oberflächlichen Blick wirft,
wer nur betrachtet und nicht sieht,
sollte sich auch nicht wundern,
wenn scheinbar nichts zu erkennen ist.
Das hat doch mit Kunst nichts zu tun, meinten Monets Kritiker. Kunst müsse künstlich sein – das steckt doch schon im Wort. Wenn einer Natur malt – na und? Monets Garten in Giverny gab reichlich Motive her, aber wenn ein Maler nicht mehr Wert auf die Wahrnehmung selbst als auf den Wahrnehmungsprozess legt, was zeigen seine Bilder dann eigentlich?
Man muss kein großer Künstler sein, um sich von der Welt nicht verstanden zu fühlen. Aber für einen großen Künstler ist es umso tragischer, von der Welt nicht verstanden zu werden. Monet musste unverstanden bleiben – nur so konnte er sich zu dem entwickeln, was heute an ihm bewundert wird. Die Darstellung seines Erlebens der Einheit mit der Natur ist nur für die sichtbar, die sich mit offenem Auge statt mit vorgefertigtem Blick auf das Wagnis einlassen können, etwas zu sehen, statt nur etwas zu betrachten.
Ach ja, Monet … wo war ich? dachte er sich.
Ach so, ja, also alles aufschreiben, wenn man des Malens nicht fähig ist.
Er versuchte also, seine Gedanken zu ordnen:
‚Wenn man einen Baum malen soll, wäre es dann wichtig, die Wurzel des Baumes zu kennen? Meistens wird von Bäumen nur das gemalt, was sichtbar ist – der Stamm, die Äste, die Zweige, die Blätter.
Aber die Wurzel? Dabei ist bei manchen Bäumen das Wurzelwerk größer und umfangreicher als der Rest, beispielsweise bei manchen Eichen. Die Wurzel ist vor allem anderen da, und ohne Wurzeln könnte ein Baum auch gar nicht existieren. Wer seine Wurzeln offen legt, ist leichter verwundbar.
Wie wäre es eigentlich, als Baum zu existieren? Es muss doch ein völlig anderes Leben sein, wenn man sein ganzes Leben immer nur an einem Ort verbringt. Und was macht man so, die ganze Zeit, als Baum? Man wächst und gedeiht, gibt anderen Lebewesen Schutz und Zuflucht, man strebt ans Licht … hmmm, dachte er, das ist wahrscheinlich der Unterschied: der Baum strebt ans Licht, um weiter wachsen zu können, aber als Mensch lebt man nicht wie ein Baum. Als Mensch lebt man eher wie eine Fliege: Man strebt ans Licht, landet aber nur in der Scheiße…‘
‚Was hat das denn jetzt mit mir zu tun?‘ fragte er sich, und verwundert reflektierte er seine Gedanken. Schon wirr, okay, aber ich soll es ja erst mal aufschreiben … gut, man kann es ja immer noch überarbeiten, und wenn es einem dann immer noch nicht gefällt, kann man es ja wieder wegwerfen. Für heute sollte das an literarischer Ambition genügen, und er hielt es für eine gute Idee, dem Nachmittag mit einem Spaziergang etwas Abwechslung zu verleihen.
Er warf seinen Mantel über, zog die Schuhe an und dann die Tür hinter sich zu. Das Wetter war für diese Jahreszeit noch recht angenehm. Als er den Weg von seinem Haus etwas außerhalb des kleinen Dorfes zur Ortsmitte hin zurückgelegt hatte, hielt er kurz inne. Irgendetwas war anders, aber was? Nachdem er sich mehrmals umgedreht hatte und das ihn umgebende Ensemble aus Bushaltestelle, Schule und Tante-Emma-Laden als ihm bereits bekannt abhaken wollte, fiel es ihm ins Auge: Man hatte eine Litfaßsäule aufgestellt, über zwei Meter hoch und schätzungsweise einen Meter oder noch mehr im Durchmesser. Solch ein Anachronismus aus längst vergangener Zeit, dachte er sich, und: wer braucht denn im Zeitalter der als Information getarnten Reizüberflutung noch so ein albernes Teil? Trotz seines zur Schau gestellten Desinteresses kam er nicht umhin, die Litfaßsäule von oben bis unten zu betrachten, und er erblickte – nichts. Eine Plakatfläche ohne ein Plakat daran, naja, obwohl – es könnte ja auch auf der anderen Seite etwas angebracht sein. Er schritt also im Uhrzeigersinn um die Litfaßsäule und ließ dabei seinen Blick immer wieder von oben nach unten schweifen, aber – nichts. Kein Plakat, keine Bekanntmachung, keine Werbung – einfach nichts.
Das Vorhandensein von nichts stimmte ihn nachdenklich. Nichts ist ja auch nicht nichts, denn sonst hätte man auch ebenso auf die Litfaßsäule verzichten können. Aber eine Litfaßsäule mit nichts – das war verdächtig. Sollte da ein Nihilist am Werke gewesen sein? Er erinnerte sich, dass er einmal in einem Varieté einen Künstler gesehen hatte, der mit leeren Händen auf die Bühne gekommen war und das geistig zunächst etwas schwerfällige Publikum mit folgender Nummer herausfordern wollte:
„Guten Abend, meine Damen und Herren. Schauen Sie genau auf meine Hände.“ Er hatte einen etwas zu engen, altmodischen Anzug an, einen gezwirbelten Schnurrbart und formte seine Hände vor seinem Bauch zu einer Art Schale. Er fuhr in einem imitierten französischen Akzent fort: „Mesdames et Messieurs, was habe ich in meinen Händen?“
Keine Reaktion aus dem Publikum. Nur Schweigen. „Ich zeige es Ihnen noch mal“, rief er nun, etwas lauter, und mit einem verschmitzten Grinsen. Und um zu demonstrieren, wie unglaublich seine Nummer sei, schritt er bis zum Bühnenrand nach vorn, hielt die Hände etwas tiefer vor seine Knie, drehte die Handflächen Richtung Publikum und fragte nochmals: „Alors, schauen Sie ganz genau hin: Was halte ich in meinen Händen?“
Nun hatte er des Publikums Interesse geweckt, und wie bei einer schlechten Fernsehserie half auch hier das Stilmittel der permanenten Wiederholung, um Aufmerksamkeit heischend Neugier beim Publikum zu erzeugen. „Es kann Ihnen doch nicht entgangen sein: was halte ich in meinen Händen? Regardez!“ Einer im Publikum setzte sich seine Lesebrille auf, um besser zu sehen. Andere beugten sich nach vorn, um die Hände des Künstlers besser in Betracht zu nehmen. Auch begann ein Stimmengemurmel, in dem sich Ehefrauen bei ihren Ehemännern Ratschlag suchend nach dem Objekt der Begierde erkundigten. Schließlich rief jemand aus den hinteren Reihen: „Nichts“. Der Magier sprang hoch, riss die Hände nach oben und frohlockte lautstark. „Ja! Sie haben es erfasst!“ Er deutete mit ausgestrecktem Arm in Richtung des Rufers. „Tres bien, Monsieur! Ich habe nichts in den Händen! Sehen sie doch nur, wie ….“ Er hielt schlagartig inne. „Oh nein! Oh mein Gott! Ich habe … ich habe es fallen lassen! Wie ungeschickt von mir.“ Mit gespieltem Entsetzen schlug er die Hände vor dem Gesicht zusammen. „Mon dieu, ich habe nichts fallen lassen. Sehen Sie nur…“ Das Publikum reckte die Köpfe nach vorne. Die weiter hinten Sitzenden versuchten nun, durch seitliches Verrenken des Kopfes am Vordermann vorbei einen Blick auf die Bühne zu ergattern. Die zunehmende Unruhe im Zuschauerraum wurde noch gesteigert, als der dickliche Mann auf der Bühne jetzt fast ekstatisch ausrief: „Es ist nichts auf den Boden gefallen! Schauen Sie doch nur! Was für ein Malheur!“ Mit imitierter Verzweiflung und sich überschlagender Stimme kreischte der Künstler: „Da auf dem Boden ist nichts! Schauen Sie doch nur! C’est une catastrophe!“ Nun war das Publikum kaum mehr zu halten; Gläser fielen klirrend von den kleinen Beistelltischen, die Menge drängte nach vorne, Stühle gingen zu Bruch und ein tumultartiger Lärm vermischte sich mit dem hysterischen Kreischen des Magiers auf der Bühne. Durch die Lautsprecheranlage des kleinen Varietés ertönte jetzt eine Durchsage: „Meine Damen und Herren, wir möchten Sie bitten, Ihre Plätze wieder einzunehmen. Es ist nichts passiert.“ Gerade der letzte Satz aber versetzte das Publikum endgültig in völlige Raserei, und die Meute begann die Bühne zu stürmen. Die Zuschauer wollten nichts gesehen haben, und dazu war dem Mob nun jedes Mittel recht. Eine ohrenbetäubende Mischung aus lautstarken Schreien, zerberstendem Mobiliar, hilflosem Kreischen, heulenden Sirenen und allgemeiner Hysterie hatte den Raum erfüllt, und es gab kein Halten mehr. Wenn alle gleichzeitig nichts wollen, kommt das einer Katastrophe biblischen Ausmaßes gleich.
‚So was in der Art muss es sein‘, dachte er sich und blickte ein letztes Mal auf die Litfaßsäule, ‚da kann man nichts machen‘.
Für ihn war der Fall klar: Es war Zeit, nach Hause zu gehen.