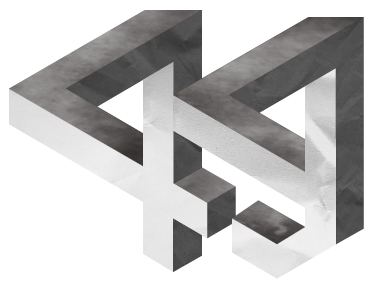Kapitel 3
15. November
Der dritte Tag nach dem Arztbesuch begann mit dem Gang zum Briefkasten. Keine Rechnungen – das war schon mal gut. Nur ein zusammengefaltetes Blatt, das wie ein Flyer aussah. Er gähnte und zog das Papier durch den Einwurfschlitz des Briefkastens nach oben heraus. Es war das Faltblatt der Kirchengemeinde, darin enthalten die frohe Botschaft: Heute ist der „Jahrestag der Aufhebung der Strafen anlässlich der offiziellen Abschaffung des Index Librorum Prohibitorum“.
Aha.
Die Abschaffung des was?
Muss man Mitglied in der katholischen Kirche sein, um zu wissen, was das ist? Nicht unbedingt. Der Vatikan gab in einer Verlautbarung bekannt, dass die Liste der Bücher, die Katholiken nicht lesen durften, nunmehr aufgehoben sei und die daraus resultierenden Strafen ab jetzt – nach über 400 Jahren – aufgehoben wären.
Aha, aha.
Und wieso hatte es eine solche Liste überhaupt gegeben?
Seit der Erfindung des Buchdruckes war der Kirche ein wichtiges Mittel zur Machtausübung abhandengekommen: Statt handschriftlich reproduzierter Bücher, die nur in geringer Stückzahl hergestellt wurden, konnte nun jedermann ein Buch erwerben und selbst lesen – sofern er denn des Lesens mächtig war. Und nicht nur das Geschriebene zu lesen war nunmehr allen frei zugänglich – ein jeder konnte sich auch noch seinen eigenen Reim auf den Text machen.
Die Liste der Autoren, deren Bücher vom Vatikan verboten waren, liest sich wie ein who is who der Literatur- und Philosophiegeschichte: Victor Hugo, Gustave Flaubert, Jonathan Swift, René Descartes, Galileo Galilei, Gotthold Ephraim Lessing, Immanuel Kant, Jean-Paul Sartre und viele andere Geistesgrößen waren mit ihren Werken in das „Verzeichnis der verbotenen Bücher“ aufgenommen worden.
Frei verfügbares Wissen und dazu noch der freie Geist der Interpretation – das konnte die beinahe allmächtige Kirche doch so nicht stehen lassen, oder?
Noch bevor er sich Gedanken um die Beantwortung dieser Frage machen konnte, hörte er plötzlich ein laut knatterndes, dröhnendes Geräusch. Ein Motorrad kam geradewegs auf ihn zugefahren, wurde langsamer, stoppte schließlich direkt vor seiner Haustür und ein Mann stieg ab.
Der Fahrer nahm den Helm ab. Lange Haare, zotteliger Zopf, dunkle Sonnenbrille, die Jeans mit Löchern übersät und: natürlich unrasiert. Es gab nur einen, der so aussah, als wäre er durch ein Loch im Raum-Zeit-Kontinuum gefallen und genau hier und jetzt gelandet: sein alter Schulkollege W.
W hieß nicht wirklich W – es war nur der Anfangsbuchstabe seines Vornamens. Und da W aus einer sehr armen Familie stammte, die so arm war, dass sie sich nicht einmal einen Nachnamen leisten konnte, hatten W und er vor zig Jahren beschlossen, dass ein Buchstabe als Vorname völlig ausreichend war.
Wie eigentlich immer in den letzten Jahrzehnten war W ohne Voranmeldung oder Ankündigung einfach mal so aufgetaucht. Das hatte auch noch nie gestört.
„Alles klar?“
W zog den Helm ab und grinste breit.
„Ja, schon. Ich dachte, ich schau mal vorbei“.
„Tja, das hast du ja hiermit auch gemacht. Also, dann: tschüss.“
„Ja, tschüss.“
Beide fingen an zu lachen.
„Immer noch die alten Sprüche, was, W?“
„Ja klar, was Neues wäre Luxus –
und Luxus kann ich mir nicht leisten.
Und bei dir?“
„Ooooch, ich bleib erst mal zu Hause.“
„Bist du krankgeschrieben?“
„Heutzutage nennt man das arbeitsunfähig.“
„Okay, bist du arbeitsunfähig geschrieben?“
„Ja.“
„Na, wenn der Arzt meint du wärst arbeitsunfähig, dann bist du auch arbeitsunfähig, oder? Wozu hat man denn sonst einen Arzt?“ W grinste. Obwohl er so aussah, als wäre er gerade aus einem Gefängnis geflüchtet, arbeitete W in der Justizvollzugsanstalt als Gefängniswärter. In Anbetracht seines Äußeren hätte man ihn sich aber auch gut auf der anderen Seite des Gitters vorstellen können. „Also dann: bleib zu Hause. Besser ist das.“
„Weißt du, W, bei uns gibt es ein Sprichwort, das heißt ‚zu Hause sterben die Leute‘. Was meinst du: stimmt das?“
„Woher soll ich das wissen? Erstens bin ich gerade nicht zu Hause und zweitens: soweit ich weiß, lebe ich noch.“
Er blickte mit leicht zugekniffenen Augen zu W.
„Also ich sehe das so“, fuhr W fort, „wenn alle zu Hause bleiben würden, gäbe es keinen Krieg“.
„Zu Hause ist aber kein Ort, sondern ein Gefühl“, entgegnete er. „etwa so wie das Paradies“. W lachte laut auf.
„Das Paradies“, äffte er den Freund nach. „Soso, und was passiert denn da? Im Paradies, meine ich?“
„Nun ja, das Paradies, so wie wir es in unserem Kulturkreis verstehen, ist ein banaler Ort, oder besser: ein banales Gefühl. Eine schöne Insel, mitten in einem strahlend blauen Ozean, Sonne und Wärme verbreiten ein Gefühl von Harmonie, in der Luft liegt ein süßer Duft und…“
„Was für eine Vorstellung“, fiel ihm W ins Wort. „Was du da beschreibst, klingt wie ein kitschiges Bild aus einem Reiseprospekt. Sommer, Sonne, schöne Frauen, Essen und Getränke so viel man will, all inclusive… und wenn man dann die Reise bucht, erlebt man sein blaues Wunder: Die Insel ist hässlich, das Wasser dreckig, die Bewohner wollen einen nur abzocken und natürlich ist das Wetter mies.“
„Ja, das ist alles richtig. Also … ich meine, es ist natürlich nicht richtig – aber es stimmt ….“
„Meine Rede“, unterbrach W ihn erneut, „deshalb soll man ja auch nicht so einen Urlaub buchen. Wieso sollte man Geld ausgeben, um sich seine Illusion vom Paradies zu zerstören, wenn man doch durch simples zu Hause bleiben Geld sparen kann und obendrein noch seine heile Welt im Kopf erhält? Man kann doch in seiner Fantasie verreisen – wann, wohin, mit wem man will.“
„Genauso ist es. Nur dieses Paradies, also ich meine die Illusion des Paradieses, die ist für viele Menschen lebensnotwendig.“
W runzelte die Stirn. „Lebensnotwendig? Das ist nicht mal überlebensnotwendig, wenn du mich fragst.“
„Ich frag dich aber nicht.“
Unter Menschen, die allzu sehr Wert auf Etikette und korrekte Umgangsformen legen, wäre ein Satz wie ‚Ich frag dich aber nicht‘ ein Grund gewesen, um beleidigt zu sein, ein Konversationskiller, ein sprachliches no go. Unter alten Freunden wie diesen beiden war es das Salz in der Suppe, und sie fanden beide Geschmack daran. „Ich frag dich aber nicht, denn es ist zweifellos lebensnotwendig. Für viele Menschen ist es die Vorstellung von absoluter Geborgenheit, von völligem Einklang mit der umgebenden Natur, von totaler Hingabe an einen Ort oder ein Gefühl des unbeschwerten Wohlbefindens. Das kennen wir doch alle. Und selbst wenn wir uns nicht daran erinnern können, wo und wann wir es erlebt haben, so bleibt doch die Erinnerung daran und die Sehnsucht danach unser Leben lang erhalten.“ W kratzte sich an seinem Dreitagebart.
„Hmmm… und was sollte das sein, wonach wir uns so sehr sehnen?“
„Ganz einfach: Es ist unser Zustand, wie wir ihn im Mutterleib vor der Geburt erfahren. Umgeben von einem uns beschützenden Fluidum, immer schön warmgehalten werden, keinen Gedanken an Nahrungsbeschaffung oder an das morgen verschwenden, der Lärm und der Dreck sind irgendwo anders … das ist in der Tat paradiesisch, findest du nicht?“ W blickte ihn stutzig an.
„Weißt du was?“, fragte er und stemmte die Hände in die Hüften. „So ein Paradies ist doch eigentlich…“ In diesem Moment unterbrach ein lautstarkes Klingeln die Rede des Freundes. „Aaach, was denn jetzt?“ rief der daraufhin genervt aus und zog sein Handy aus der Hosentasche. „Ja?“. Er horchte eine Zeit lang ungeduldig den Worten am anderen Ende der Leitung. „Was, jetzt gleich?“ Wieder lauschte er. Nur begann er jetzt, die Augen nach oben zu verdrehen und mit dem Fuß aufzustampfen. „Kann das nicht jemand anderes übernehmen? Ich bin gerade in einer Besprechung.“ Die Stimme am anderen Ende wurde lauter, die Worte folgten schneller aufeinander. W schlug sich mit der flachen Hand an die Stirn. „Jaja, schon gut“ herrschte er sein Gegenüber im Telefon an, „ich fahre sofort los. Also, bis gleich.“ Mit einem Schnauben zog er seinen Helm wieder über den Kopf.
„War das deine Frau?“
„Nein, mein Chef“ entgegnete W. „Meine Frau würde niemals so mit mir sprechen.“
„Ja, stimmt. Ihr führt eine beneidenswert harmonische Ehe.“
W grinste vielsagend. „Ja, unsere Ehe ist wirklich sehr ungewöhnlich… weißt du was? Wir sind seit rund 20 Jahren verheiratet, aber von Abnutzungserscheinungen keine Spur.“
„Das freut mich ehrlich für dich. Also … verrate es mir: Was ist das Erfolgsgeheimnis?“
„Sex.“ Ws Antwort kam ebenso prompt wie überzeugend: „Spontaner, abwechslungsreicher und wilder Sex….“ Ws Augen fingen an zu leuchten. „Mindestens fünfmal mal pro Woche!“
„Wow, das ist … beeindruckend!“
„Ja“ pflichtete W ihm bei. „Das Problem ist nur…“ er hielt kurz inne. Dann blickte sich W um, beugte sich zum Freund hinüber und flüsterte ihm ins Ohr: „Das Problem ist nur: wenn meine Frau davon erfährt, bin ich erledigt!“
In diesem Moment klingelte Ws Handy noch einmal. W warf einen kurzen Blick auf das Display, steckte das Telefon einfach wieder in die Jackentasche und schloss das Visier seines Helmes. „Also“ sprach er und stieg wieder auf das Motorrad, „war schön“.
„Ja, schön… aber eigentlich noch nicht fertig… Na ja, … dann bis dann“.
Das Motorrad wurde lautstark gestartet und verschwand ebenso schnell, wie es gekommen war.
„Jahrestag der Aufhebung der Strafen anlässlich der offiziellen Abschaffung des Index Librorum Prohibitorum“. Er blickte auf den Zettel in seiner Hand und fing an zu grinsen.
‚Wenn die wüssten…‘, dachte er bei sich und ging zurück ins Haus.