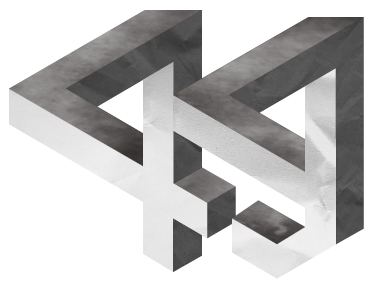Kapitel 37
19. Dezember
„Wir unterscheiden also zwischen Syntax und Semantik, zwischen Zeichen und Bedeutung, oder anders ausgedrückt: zwischen Form und Inhalt. Für die Form – die Symbole der Darstellung – sind unsere Computerspezialisten zuständig, für den Inhalt – also den Sinn – benötigen wir die Interpretation unserer Geisteswissenschaftler. Wie bereits erwähnt, wird unser Projekt in zwei parallel und unabhängig voneinander arbeitenden, paritätisch besetzten Gruppen stattfinden. Gibt es hierzu Fragen?“
„Ja, Herr Direktor“ Eine Person aus dem Team der Computerspezialisten hatte sich zu Wort gemeldet. „Da wir zur Durchführung unseres Projektes nur einen begrenzten Zeitrahmen zur Verfügung haben, wäre es doch vielleicht auch eine Überlegung wert, alle Kräfte zu bündeln und in einem großen gemeinsamen Team zu arbeiten, finden Sie nicht?“
„Ja, Bytes, das stimmt, aber…“ Der Direktor machte eine kurze Sprechpause, vergrub die Hände in den Taschen seines weißen Mantels und begann, vor dem versammelten Team von links nach rechts zu laufen. Er schaute dabei mit konzentriertem Blick zu Boden, so als ob er seinen Weg suchen würde. Einen Weg, den er nur finden könnte, indem er ihn aufmerksam und unbeirrt ging. Als er an der Wand des Saales ankam, machte er kehrt und lief in derselben, leicht gebückten Haltung von rechts nach links. „Ja, das stimmt, aber – es ist nicht richtig.“
Die Programmiererin sah den Direktor erwartungsvoll an. Dass er einen Vorschlag, der nicht seinem Hirn entsprungen war, ablehnte – das war für das Team nichts wirklich Neues. Aber es wäre doch hilfreich, eine Erklärung dafür zu erhalten. Also erhob Bytes die Stimme erneut, um nachzuhaken:
„Herr Direktor, ich will ja nicht…“
„Tun Sie aber, Bytes, tun Sie aber.“ Bytes verstummte.
„Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie so jäh unterbrechen muss, aber Sie selbst haben ja auf unser Zeitlimit hingewiesen. Ihr Einwand ist durchaus berechtigt, aber leider nicht zu Ende gedacht. Um Ihre Frage zu beantworten, gebe ich diese an unsere beiden Teamleiter weiter. Frau Dr. Starr – bitte sehr.“ Mit einer generösen Handbewegung erteilte der Direktor der Wissenschaftlerin das Wort. Nachdem er selbst wieder an der linken Wand des Saales angekommen war, drehte er sich um – weiterhin mit dem Blick auf seine Wegstrecke vor sich gerichtet, nun aber mit hinter dem Rücken verschränkten Armen.
„Danke, Herr Direktor“ Dieser schlenderte nun wieder von links nach rechts vor der versammelten Mannschaft, und mit nickendem Kopf erwartete er Dr. Starrs Beantwortung der Bytes’schen Frage. „Sehen Sie“ fing die Wissenschaftlerin ihre Erklärung an, „wir sind ja alle Wissenschaftler und daher einer wissenschaftlichen Vorgehensweise verpflichtet. Unsere Aufteilung in zwei Gruppen hat einen einfachen Grund: die Verifikation, das heißt, die Überprüfbarkeit der Ergebnisse auf ihre Richtigkeit hin:
Erzielt nun die erste Gruppe unter meiner Leitung ein Ergebnis, das mit dem Ergebnis der zweiten Gruppe unter der Leitung von Professor Feder identisch ist, so können wir davon ausgehen, dass unsere Resultate korrekt sind. Zwar ist von Bertrand Russell das Zitat überliefert ‚Auch wenn alle einer Meinung sind, können alle Unrecht haben‘, aber dennoch: die Wahrscheinlichkeit zweier fehlerhafter Arbeitsprozesse mit identischem Ausgang ist äußerst gering.
Im zweiten Fall – den wir natürlich nicht zu erzielen wünschen – kommen die beiden Teams in ihrer jeweiligen Arbeit zu unterschiedlichen Ergebnissen. Hieraus resultieren nun mehrere Optionen:
a) das Ergebnis der ersten Gruppe ist richtig und somit das Ergebnis der zweiten Gruppe falsch oder
b) das Ergebnis der zweiten Gruppe ist richtig und damit das Ergebnis der ersten Gruppe falsch oder
c) das worst-case-Szenario: die Ergebnisse beider Gruppen sind falsch.“
„Aaah, ich verstehe“ gab Bytes zurück, und im Saal wurde das Verständnis für diese Vorgehensweise durch Nicken und zustimmende Artikulationen bekundet.
„Allerdings…“ nun hatte sich auch der zweite Gruppenleiter zu Wort gemeldet „Allerdings haben wir hier nur die Methodik definiert.“ Professor Feder hatte nun die Aufmerksamkeit im Saal auf sich gezogen. „…und diese Methodik schließt noch zwei Sonderfälle ein: wenn – wie im worst-case-Szenario angedeutet – die Ergebnisse beider Gruppen falsch sind: woran erkennt man diese Konstellation? Dass eines der beiden Ergebnisse nicht stimmen kann – nun, ich denke, das ist jedem klar. Aber zwei Fehler könnte man ja kaum konstatieren, wenn man nicht auch Kenntnis über das richtige Ergebnis hätte, wozu es allerdings dann einer dritten Gruppe bedürfte – die aber die Möglichkeit, dass alle Gruppen mit ihren Ergebnissen falsch liegen, wiederum nun auf drei erhöhen würde und somit den Unsicherheitsfaktor nicht verringern würde. Umgekehrterweise wäre aber bei drei Gruppen die Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit des Ergebnisses höher, denn wenn zwei Gruppen dasselbe Ergebnis erzielten und die dritte Gruppe zu einem abweichenden Resultat käme, könnte man davon ausgehen, dass nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit die häufiger vorhandene Lösung auch die richtige ist.“ Das zustimmende Raunen im Saal hätte Professor Feder nun zum Anlass nehmen können, seine Ausführungen an dieser Stelle zu beenden. Stattdessen aber übernahm nun die Leiterin der ersten Gruppe wieder das Wort und fuhr fort, den Gedankenansatz des Kollegen weiterzuführen.
„Wir müssen aber auch betrachten, dass in dieser weiter fortschreitenden Quantität keine Steigerung der Qualität liegt, sondern eher ein Risiko.“ Die Stimmen im Saal verstummten, und alle richteten ihre Aufmerksamkeit nun wieder auf Dr. Starr. „Es ist nämlich so,“ fuhr die Wissenschaftlerin fort „dass man nun meinen könnte: Je mehr Gruppen wir bilden, desto höher die Wahrscheinlichkeit der Verifikation unseres Ergebnisses. Dem ist aber nicht so. Denkt man diesen Ansatz zu Ende, könnte jeder hier im Saal allein vor sich hinarbeiten, und am Schluss nehmen wir einfach das als Ergebnis, was am häufigsten postuliert wird. In der Einzelarbeit ist aber die zu erwartende Fehlerhäufigkeit ungleich größer, da das korrigierende Element einer zweiten Betrachtung entfällt.
Aus der Mathematik kennen wir ja das Braess-Paradoxon:
Selbst wenn jedes Mitglied einer Gruppe sich seiner individuellen Perspektive gemäß unter rationalen Aspekten betrachtet richtig entscheidet, kann eine zusätzliche Option des Handelns des Einzelnen zur negativen Entwicklung für die Situation aller Beteiligten führen. Vereinfacht ausgedrückt: mehr ist nicht unbedingt besser. Daher haben wir also zwei Gruppen gebildet, um innerhalb der jeweiligen Gruppe die Fehlerwahrscheinlichkeit zu minimieren und erst dann das Gruppenergebnis mit dem Ergebnis der anderen Gruppe zu vergleichen.“
„Danke für Ihre Ausführungen, Dr. Starr und Professor Feder.“ Nun hatte sich der Direktor wieder ins Geschehen eingeklinkt. „Sie sehen also, wir haben praktisch an alles gedacht. Gibt es noch Fragen?“ In der scheinbaren Erwartung, keine weiteren Wortmeldungen mehr zu erhalten, verschränkte der Direktor die Arme vor der Brust und sah über den Rand seiner Brille hinweg zu den angesprochenen Wissenschaftlern. Für ein paar Momente war nichts zu hören, und scheinbar war man sich einig, alles Wissenswerte erfahren zu haben und nichts dem Zufall zu überlassen. Dennoch meldete sich eine Stimme zu Wort.
„Ääähm, ja… eine Frage hätte ich tatsächlich noch, Herr Direktor.“ „Ach, unser Filmvorführer.“ Mit großzügiger Geste und fast schon Sympathie signalisierender Stimme erteilte der Projektleiter dem Angesprochenen das Wort. „Wie lautet denn Ihre Frage?“
„Nun, ich weiß… es klingt unwahrscheinlich … aber Sie selbst hatten ja darauf hingewiesen, immer alle in Frage kommenden Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, auch wenn diese auf Anhieb betrachtet völlig absurd klingen mögen und…“
„Ihre Frage, Herr Filmvorführer“. Der Ton des Direktors war nun wieder strenger. „Ihre Frage, bitte.“
„Ääähem … ja gut, natürlich. Also – ich frage mich: wie wäre es denn, wenn beide Gruppen zu unterschiedlichen Ergebnissen kämen und beide Resultate richtig wären?“
‚Auf ein und dieselbe Frage kann es durchaus mehrere richtige Antworten geben‘, dachte er sich, während er noch zauderte, wer denn am heutigen 19. Dezember am ehesten erwähnenswert sei. Bei den Geburtstagen käme da der französische Schriftsteller Jean Genet in Frage oder auch dessen Landsmännin Edith Piaf, die wohl großartigste Chansonsängerin aller Zeiten. Zu den Todestagen fiel ihm Alois Alzheimer ein, der hier ganz in der Nähe geborene Psychiater und Neuropathologe, der als Namensgeber einer bis dahin kaum erforschten Demenz-Erkrankung fungierte. Oder Emily Brontë, die englische Schriftstellerin, deren einziger Roman „Wuthering Heights“ von der Sängerin Kate Bush in kongenialer Form adaptiert wurde. Interessanterweise hatten Bush und Brontë am selben Tag – dem 30. Juli – Geburtstag, nur eben mit 140 Jahren Abstand.
Ja, sie allen waren erwähnenswert. Besonders Kate Bush hatte ihn mit ihrer äußerst individuellen Herangehensweise beim Komponieren, Arrangieren und Singen geprägt. Man musste bei ihr immer auf alles gefasst sein, und dennoch passierte besonders auf ihren frühen Aufnahmen oft das völlig Unerwartete, etwas seltsam Bizarres, das bei mehrfachem intensivem Hören ihrer Platten auch noch an Kontur gewann. Je verrückter die Dinge waren, die Kate Bush in ihrem Studio produzierte, desto mehr bewunderte er sie eben genau dafür. Es war damals herrlich für einen Teenager wie ihn, dieser nur ein paar Jahre älteren Eigenbrötlerin dabei zuzuhören, wie sie sich mühelos über musikalische Erwartungshaltungen und Hörgewohnheiten hinwegsetzte, um ihren ganz eigenen Sound zu kreieren. In seinen ersten ungelenken Musikaufnahmen versuchte er vergebens, diesem Wunderkind nachzueifern, um musikalisch wenigstens in ihrer Nähe zu sein. Für ihn war Kate Bush wie eine Königin – doch nicht jeder, der sich in der Nähe der Königin aufhält, ist auch ein König. Manchmal ist es auch nur der Hofnarr.