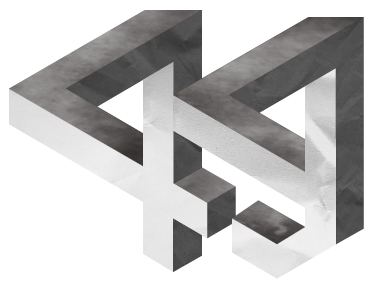Kapitel 11
23. November
Nachdem er in der letzten Nacht lange unterwegs war – sowohl körperlich als auch im Geist – ließ er den nächsten Tag langsam beginnen. Nach einer Tasse Tee wollte er mit seinen Aufzeichnungen weitermachen, und weil er zunächst keinen Einstieg fand, fing er mit dem Datum an. 23. November – irgendein bemerkenswertes historisches Ereignis, dass mit diesem Tag verbunden ist? Ja, natürlich – es ist der Todestag von Klaus Kinski.
Was fiel einem zu Kinski nicht alles ein? Fabelhafter Schauspieler, größenwahnsinniger Sexprotz, exzellenter Rezitator, gemeingefährlicher Aggressor, detailverliebter Autodidakt… kaum eine andere Figur konnte gleichermaßen faszinierend, abstoßend, widersprüchlich und dennoch eindeutig sein. Viele seiner Filme drehte Kinski – wie er selbst ohne Umschweife bekannte und ähnlich wie Orson Welles – nur des Geldes wegen.
Bei Welles, dem US-amerikanischen Universalgenie, dessen Erstlingswerk „Citizen Kane“ auch heute noch bei Umfragen nach dem besten Film aller Zeiten stets ganz vorne liegt, stand immer ein übergeordneter Aspekt hinter dem scheinbaren Ausverkauf seines künstlerischen Selbst: von den üppigen Gagen der für Welles‘ Verhältnisse eher mittelmäßigen Hollywood-Filmchen konnte er seine cineastisch hoch ambitionierten eigenen Produktionen realisieren. Ohne den kommerziellen Erfolg von „Der dritte Mann“ hätte es Meisterwerke wie „Chimes at Midnight“ wahrscheinlich nie gegeben. In diesem von Kritikern hochgelobten Werk verdichtete Welles als Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller die Dialoge und Handlungsstränge von fünf Shakespeare-Stücken in ein einziges Werk. Das war für den gewöhnlichen Kinobesucher nicht mehr nachvollziehbar – zu vielschichtig war die komplexe Handlung, zu raffiniert die Übergänge zwischen den einzelnen Erzähl-Ebenen. Die Folge war absehbar: Welles war für Liebhaber großer Schauspielkunst zusammen mit Sir John Gielgud und Jeanne Moreau in bisher unerreichte Sphären vorgedrungen, musste aber in der Filmindustrie den Ruf des Kassengiftes über sich ergehen lassen.
Ähnlich gelagert war Kinski, der die Gagen seiner erfolgreichen Filme nicht in Eigenproduktionen investierte, sondern mit seinem verschwenderischen Lebensstil verprasste. Dabei war die Schauspielerei nur eines seiner hoch ausgeprägten Talente: Die Rezitationen Kinskis von klassischer Weltliteratur wurden auf damals so genannten Sprechplatten veröffentlicht und erreichten hohe Verkaufszahlen. Egal ob Villon, Rimbaud, Goethe, Schiller oder Brecht – Kinskis Aufnahmen der Werke dieser Dichter zählen zweifellos zu den Sternstunden des gesprochenen Wortes. Mit der Verbindung aus Rezitation und Schauspiel reiste Kinski jahrelang als Ein-Mann-Theater durch die Lande, bis er bei der Premiere seines selbst verfassten Stückes „Jesus Christus Erlöser“ einen seiner gefürchteten Wutanfälle einschließlich lautstarker Beleidigung des Publikums zum Besten gab. Die Kritiker verrissen die Vorstellung; für die Boulevardpresse war das ausrastende enfant terrible Kinski in puncto Auflagenzahlen einfach viel interessanter als der inhaltlich starke Text. Wieder einmal sprach man mehr über den übellaunigen Künstler als über seine überragende Kunst.
Was hatte all das mit seinem Leben zu tun? Wollte er nicht seine Geschichte aufschreiben, statt die Geschichten anderer Menschen zu erzählen? Trotz aller Überschaubarkeit seines eigenen künstlerischen Potentials hatte er festgestellt, dass ihn mit Kinski und Welles doch einiges verband: auch er hatte kommerzielle Jobs wie den des Audioproduzenten von Rundfunkspots in einer Werbeagentur angenommen, um seine eigenen Projekte finanziell unabhängig und von äußeren Zwängen unbeeinflusst vorantreiben zu können:
Seine literarischen Versuche mit der etwas seltsam anmutenden Familiensaga über eine Unternehmerdynastie konnte man auch als Parodie auf die Buddenbrooks lesen, und die Protagonisten des Buches trugen alle Vornamen, die auf die Mitglieder der Familie Mann Bezug nahmen.
Sein tontechnisches Schaffen waren meist Auftragswerke in der Funktion als Audio-Engineer und Produzent für andere Musiker; das meiste davon für lokale und regionale Produktionen. Auch hatte er ein für einige Hörbücher und Hörspiele verantwortlich gezeichnet. Nur manchmal konnte er überregional beachtet in Erscheinung treten, wie mit dem von der Berliner „Akademie der Künste“ präsentierten Hörspiel, das folglich auch im einzigen landesweiten Radiosender ausgestrahlt wurde.
Aber was bedeutet es schon, als Künstler nicht wahrgenommen zu werden, wenn man aus seinem beruflichen Tun doch eine Befriedigung erzielt, die für die meisten Menschen Zeit ihres Lebens unbekannt bleibt? Es ist eben ein Unterschied, ob man einen Job macht oder seiner Berufung nachgeht. Daher kommt auch das Wort Beruf: von „Berufung“. Alles andere sind eben nur Tätigkeiten. Das tätig sein, also das beschäftigt sein mit irgendetwas, nennt sich im Englischen „to be busied with“ und ist bei korrekter Übersetzung ins Deutsche also weitaus banaler als es das viel zitierte „Business“ vermuten lässt. Worte wie Show-Business, Big Business, Business-Partner und Business-Trip gaukeln große Welt vor und sind bei genauerer Betrachtung doch wie kleine Füße, die in viel zu großen Schuhen stecken.
Woher kam überhaupt diese sinnlose Überbewertung der Arbeit? Warum definieren sich Menschen über ihre Beschäftigung? Früher galt die Arbeit als notwendiges Übel – gerade blöde genug für die, denen es nicht vergönnt war, ohne eigene Arbeit zu leben. Wer es sich leisten konnte, lebte in den Tag hinein, ohne dauernd die „WmSb“-Frage beantworten zu müssen. Erst in den letzten Jahren war es schick geworden, bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit sein Gegenüber zu fragen: „Was machen Sie beruflich?“. Auf Partys war es am schlimmsten, sobald keiner der anwesenden Gäste mehr unter 30 war.
Aber er wollte über seine frühen Jahre schreiben. Gab es da auch was zum Thema Arbeit? Er erinnerte sich, dass sein Physiklehrer die Parameter der Arbeit erklärt hatte: „Arbeit ist das Produkt aus Kraft und Weg. Wird bei gleichbleibendem Weg die Kraft erhöht, so erhöht sich demnach auch die Arbeit. Gleiches gilt, wenn sich bei unverändertem Kraftaufwand der Weg verlängern sollte. Es handelt sich also in beiden Fällen um eine direkte Proportionalität.“
Und was ist mit Leistung? Schließlich leben wir ja nicht in einer Arbeitsgesellschaft, sondern in einer Leistungsgesellschaft. Auch das hatte man ihm in seiner Schulzeit erklärt: „Leistung ist das Verhältnis von Arbeit zu Zeit, genauer: Arbeit geteilt durch Zeit. Da die Arbeit bei dieser Formel im Zähler steht und die hierfür aufgewendete Zeit den Nenner bildet, ergibt sich daraus, dass sich bei einer Zunahme der Arbeit in der gleichen Zeit die Leistung erhöht. Dies trifft auch zu, wenn ein unverändertes Maß an Arbeit in kürzerer Zeit bewerkstelligt wird. Beide Aussagen erfüllen also die Kriterien einer indirekten Proportionalität.“
Soso, sehr interessant, dachte er sich. Und darauf beruht unser gesamtes Gesellschaftsmodell? Mehr arbeiten oder weniger Zeit zur Verfügung haben? Was für ein seltsames Ideal.
Es war mit seiner Idealvorstellung vom Leben kaum vereinbar. Kraft und Weg und Zeit standen für ihn in einem ganz anderen Verhältnis zueinander. Vor langer Zeit hatte er mal einen Sticker auf einem Auto gesehen, auf dem zu lesen stand: „Wenn ich die Kraft dazu hätte, würde ich gar nichts machen“. Er wandelte den Spruch auf seine aktuelle Lebenssituation ab und schuf sich somit ein neues Credo: „Wenn ich die Zeit dazu hätte, würde ich gar nichts machen.“
Das hatte nichts Anzügliches – mit etwas wohlmeinender Argumentation kann man sich dabei sogar auf eine Vorgehensweise berufen, die genauso praktiziert wurde von einem der größten Logiker der gesamten Philosophiegeschichte, dessen Geburtstag am nächsten Tag bevorstand:
Baruch de Spinoza.